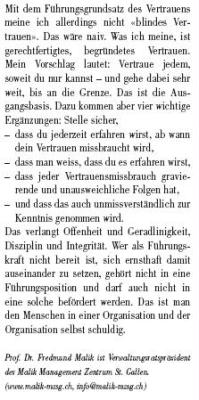Medien
Krawall-Zug durch die Kreise 4 und 5 in Zürich am 7. Februar. Ohne Vorankündigung auf eine total unvorbereitete Polizei treffend. Dieser Zug verkörpert zwei Zeitgeistphänomene, die sich garantiert weiter verstärken werden.
1. die zunehmenden und gewalttätigen Unruhen vor dem Hintergrund sozialer Verwerfungen, wiederum vor dem Hintergrund der Globalisierung und damit einhergehender politischer Veränderungen. Wachsende Spaltung zwischen Gewinnern und Verlierern. Bizarre Ungleichverteilungen von Einkommen & Kapital. Auslöser dafür ist die Anarchie auf den globalen Finanzmärkten und die Dekadenz der dortigen Akteure. Der Schwanz wedelt mit dem Hund, und zwar schon seit fast 30 Jahren.
2. Die Instant-Kommunikation über soziale Netzwerke und die damit verbundene Unkontrollierbarkeit der Massen durch staatliche Organe.
http://www.tagesanzeiger.ch/zuerich/stadt/Dann-hat-er-auf-mich-eingeschlagen/story/31386129tankwarth - 8. Feb, 14:13
Interview von Mark van Huisseling mit Roger Köppel
«Also der Mann ist ja relativ einfach gestrickt. Er stolpert durchs Leben, und die Frau hat den Auftrag, ihn zu zivilisieren. Sie ist ihm grundsätzlich überlegen, ist das stärkere Geschlecht. Ein griechischer Frauenarzt hat mir gesagt: ‹Frauen funktionieren fünfzig Prozent der Zeit absolut normal – und fünfzig Prozent sind sie ein absolutes Mysterium›, er ist 67, Hochschuldozent, hat Tausende von Patientinnen gehabt.»
«Unsere finest hour war vielleicht, als wir Kylie Minogue interviewten zusammen, nicht? Ich hab dabei viel gelernt von dir. Deine Frage, die einzige, glaub ich, nebenbei, war: ‹Was ist das Wichtigste, was Sie gelernt haben von Ihren Eltern?›» – «Komisch, ich hätte besser gefragt: ‹Wie ist Ihre Handynummer?›» – «Ja, aber was ist das Wichtigste, was du gelernt hast von deinen Eltern?» – «Mein Vater hat immer gesagt: ‹Du musst ein bisschen besser sein als die andern, aber nicht viel besser, sonst machen sie dich fertig.›»
tankwarth - 3. Jun, 10:04

Von Marcel Gamma
Rollenspiele im Internet entwickeln sich zum eigentlichen Massenphänomen. So betreuen
20 000 SchweizerInnen ein eigenes Fussballteam. Täglich, vielleicht für immer.
«Hattrick strukturiert meine Woche», erzählt Oliver Weinstock. Der 36-jährige Marketingfachmann hat unter dem Namen «goetti» als Manager bei der schwedischen Website www.hattrick.org die Geschicke eines virtuellen Fussballklubs übernommen. Nun muss er per Mausklick und via Webbrowser seine Spieler richtig trainieren, gegnerische Teams analysieren, Geld zum Kauf von Stars scheffeln und warten, bis wieder ein Spiel ansteht. Während des Matchs selbst haben ManagerInnen gleich viel Einfluss auf ihre Teams wie im Letzigrund oder St.-Jakob-Park – keinen. Hilflos müssen sie einen Textticker verfolgen, der regelmässig News vom Server-Spielfeld bringt: «Um ein Haar hätte Raul Keiter in der 62. Minute ein Tor erzielt», heisst es da. «Sein traumhafter Flugkopfball konnte nur durch eine grandiose Parade von Philippe Mummertz abgewehrt werden.» Es sind Computerprogramme, die aufgrund von Anweisungen der ManagerInnen und verschiedenster weiterer Faktoren (wie dem Formstand eines Spielers) berechnen, wie ein «Match» ausgeht.
«Es ist sehr emotional», sagt Manager «derwolf». Der 31-jährige Grafiker Moritz Wolf sitzt regelmässig wie viele ManagerInnen während zwei Mal 45 Minuten nervös vor dem Computerbildschirm und zittert mit seinem Team. «Es ist eigentlich absurd», sagt er und lacht. «Wir sind ja alle bessere Trainer als Köbi Kuhn», sagt «bad_x» alias der 40-jährige Illustrator Christophe Badoux. «Es ist extrem befriedigend, wenn du mit deiner Strategie Recht behältst. Dann bist du ein virtueller Macchiavelli.» Der Erfolg sei umso wichtiger, ergänzt der 27-jährige Marketingfachmann Pascal Jaberg, als «tankwarth» ein erfolgreicher Manager, wenn «sein» realer FC St. Gallen schlecht spiele, wie jetzt gerade.
«Moritz Leuenberger» ausser Form
Im Prinzip ist Hattrick ein so genanntes Massively Multiplayer Roleplay Game, wie es sie viele gibt. Wie auch Everquest, das bekannteste des Genres, setzt Hattrick Elemente von Strategie-Games in einem Rollenspiel ein. In Everquest bewegt man sich in einer Fantasy-Welt, schleicht als fieser Dieb im Flackern der Fackeln durch Burgen und schmiedet als nobler Fürst politische Allianzen mit Trollen.
Hattrick dagegen orientiert sich mit dem Meisterschaftscharakter stärker an der Realität, schliesslich wird ein Match gar von fünfzehn Minuten Pause unterbrochen, und eine virtuelle Saison dauert sechzehn Wochen. Alle befragten ManagerInnen sind zudem überzeugt, auch nicht beeinflussbare Parameter wie «Pech» seien im Computerprogramm vorhanden. «derwolf» erzählt erfreut, seine Freundin habe bemerkt, Hattrick sei «wie richtig», und «goetti» fügt an, gerade die Langsamkeit sei faszinierend. «Es kann ein Jahr dauern, um einen Spieler aufzubauen.»
Die Anlehnung an die Realität erreicht gelegentlich auch skurrile Dimensionen. So listet der «FC Neuchâtel» einen Spieler namens «Moritz Leuenberger» auf: «26 Jahre, katastrophal in Form, gesund. Er ist eine umstrittene Person und darüber hinaus ruhig und unehrlich», wird er charakterisiert, «seine Erfahrung ist armselig, und seine Führungsqualitäten sind schwach.»
Liebesaffären und Kiffer
Hattrick lässt den ManagerInnen im Vergleich zu ähnlichen Spielen viele Freiheiten, ihre Rolle zu interpretieren. So geniessen manche die Anonymität des Pseudonyms. Zu ihnen gehört Managerin «waloman», die als eine der wenigen Frauen bei Hattrick ist. Sie will Fussball spielen, «nicht Frauenfussball», und möchte ihren bürgerlichen Namen auch nicht in der WOZ stehen haben.
Während die einen gelegentlich mal die Website auf Neuigkeiten abklicken, können so genannte «Supporter» ihren Klub vielfältig darstellen und eine eigentliche «Corporate Identity» entwickeln. Während das eigentliche Spiel gratis ist, überweisen sie dreissig Franken pro Jahr nach Schweden. Dafür können sie eigene Klublogos gestalten und Pressemitteilungen veröffentlichen. «Je mehr Presseerklärungen, desto spannender», findet «goetti».
Illustrator «bad_x» will seinen Spielern gar Gesichter verleihen, «derwolf» betreibt wie hunderte von ManagerInnen eine eigene Website für seine «Superkickers» und gestaltet zu jedem Spiel ein eigenes Online-Plakat. Über hundert sind es bislang, und gelegentlich gerät er beim Gestalten dann in Zeitdruck und Stress. Einem Spieler hat er gar eine Affäre mit der Physiotherapeutin angedichtet, doch diese Belebung der Fussballerbiografie wurde ihm dann doch zu zeitaufwendig. «bad_x» zeigt sich überzeugt, die Formschwäche eines seiner Stars begründe sich in übermässigem Kiffen.
250 000 Gleichgesinnte
Alle Rollenspielanbieter – sei es Hattrick oder Everquest – fördern die «Community», das Kommunizieren unter Gleichgesinnten. Hattrick gehört zu den erfolgreicheren des Genres, das zum eigentlichen Phänomen geworden ist: Über 250 000 selbst ernannte FussballmanagerInnen aus 50 Ländern von Al Maghrib (Marokko) bis Vietnam haben sich angemeldet, darunter über 20 000 SchweizerInnen.
Neben dem Wettbewerbscharakter sei «Fachsimpeln mit Gleichgesinnten das Wichtigste», bringt «tankwarth» die Faszination auf den Punkt. In Chats und dutzenden von Diskussionsforen suchen die ManagerInnen Antworten, Tipps und Kontakt. Fast alle halten den Mittwoch heilig, um ein Freundschaftsspiel auszutragen, das gleichzeitig die eigene Mannschaft fit halten soll. «Jetzt kommuniziere ich wieder mit meinem Bruder», meint «bad_x», die beiden bestreiten einen privaten, nach ihrem Vater benannten Cup.
Ein spieleigenes Mail- und SMS-System gehört zu den weiteren «Arbeitsinstrumenten», da befragt «bad_x» schon mal KollegInnen über einen künftigen Konkurrenten oder ärgert sich über die taktischen Tipps eines direkten Gegners, während sich «tankwarth» gerne an den Telefonanruf eines Unbekannten aus Neuchâtel erinnert.
Was in andern Games Clans heisst, nennt sich hier Föderationen: Das sind Gruppen von Gleichgesinnten, die bis über tausend Mitglieder zählen können. «derwolf» ist einer von über hundert ManagerInnen aus der Schweiz, Deutschland, Österreich und Liechtenstein, die – so die eigene Website «Best of Hattrick» – «coole Vereinslogos, abstrakte Spielberichte und krasse Managerfehler» sammeln. «tankwarth» ist gleich in drei Föderationen dabei. «Hätte auch meine Freundin ein Team», so «derwolf», «wir würden über nichts anderes als Hattrick reden.»
In eigenen Cups trifft man sich persönlich; so fieberten in Zürich Hattrick-ManagerInnen, die auch den FC Zürich anfeuern, kürzlich in der Letzigrund-Fanbar Flachpass auf Grossleinwand mit ihren virtuellen Teams mit. Als einzige der befragten ManagerInnen erklärt «waloman», sie wolle Fussball spielen, nicht mailen. «Es ist doch nur ein Spiel.»
«Gerade eine ruhige Phase»
Theoretisch kann man sich bei Hattrick gelegentlich mal zehn Minuten einloggen und nachsehen, was so passiert ist, während man bei PC-Games durchaus bis zu vier Stunden am Stück benötigt, um das Spiel zu beenden, und sich manchmal nächtelang immer neue Duelle liefert. «Es ist wie Mails checken», meint «bad_x», während «tankwarth» ungerne in die Ferien verreist, ohne sein Team betreuen zu können. Er nutze dann SMS-Infodienste und Internet-Cafés. Er konstatiert gegenwärtig gerade eine «ruhige Phase» bei sich selbst, sprich, er hat sich an diesem Tag noch nie bei www.hattrick.org eingeloggt. «derwolf» schätzt seinen Aufwand auf etwa drei Stunden pro Woche für Plakate und Vorbereitungen, aber, so der Viertliga-Manager, in den drei Topligen könne man nur mithalten «ohne Freundin und ohne Job».
«Botteron666» hat erst eine Saison hinter sich gebracht und nennt das Spiel «eine lustige Nebensache», doch weil er in einem anderen Online-Fussball-ManagerInnen-Spiel viel Zeit verbrachte, will der 30-jährige Basler, der bald eine neue Stelle antritt, seinen künftigen Chef nicht aufschrecken, indem er seinen bürgerlichen Namen offen legt. Schliesslich könnte die Firma verbieten, www.hattrick.org anzuwählen.
«Ein Hattrickspiel hat kein festes Ende», heisst es schon auf der Einstiegsseite von Hattrick. «waloman» hätte als einzige der Befragten fast aufgehört, denn wegen vieler Verletzter ist ihr FC Chreis4 letzte Saison abgestiegen, gleich zum zweiten Mal in Folge. «Aber ich kann ja mein Team nicht im Stich lassen, nach all dem.»
tankwarth - 20. Mär, 12:29
Dem Titel Ihres neuen Buchs zufolge sind Sie aber «Ein Mann ohne Land». Wo fühlen Sie sich zu Hause?
Ich fühle mich so wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals sagte ich: Ich habe als GI in Deutschland alles getan, was von mir erwartet wurde, kann ich jetzt bitte nach Hause gehn? Als ich meinen Roman «Timequake» beendete und beschloss, nie mehr etwas zu schreiben, ging’s mir ebenso: Ich habe alles getan, was von mir erwartet wurde – Kinder grossgezogen, Bücher geschrieben. Kann ich jetzt bitte nach Hause gehn? In beiden Fällen meinte ich mit «nach Hause» Indianapolis, Indiana, als ich neun Jahre alt war und eine Mutter, einen Vater, eine Schwester, einen Bruder, einen Hund und eine Katze hatte.
Wenn jede Demokratie den tragischen Fehler eines verrückten Präsidenten hat, was wäre dann eine Alternative zur Demokratie?Selbstmord. Albert Camus bekam einen Nobelpreis dafür, dass er sagte, das Leben sei absurd. Seiner Ansicht nach bestand das einzige relevante philosophische Problem in der Frage: Warum nicht Selbstmord begehen? Ich neige dazu, ihm zuzustimmen. Camus hatte Glück, er kam bei einem Autounfall ums Leben. Aber meine Mutter beging Selbstmord, mein Literaturagent beging Selbstmord, und mein Doktorvater beging Selbstmord. Sie waren so unglücklich hier, dass sie gingen. Und das ist okay.
Sie rauchen seit siebzig Jahren filterlose Pall Malls......ein ehrenhafter Versuch, Selbstmord zu begehen, der aber bisher nicht funktioniert hat. Die Zigarettenfirma verspricht mir seit Jahrzehnten, mich umzubringen, so steht’s auf jedem Päckchen. Und was ist? Ich bin jetzt 83 und lebe immer noch. Ich überlege mir ernsthaft, die Firma zu verklagen.
Dann halten Sie den Tod für eine erweiterte Version des Schlafes?
Natürlich. Wenn ich mir anhöre, was unsere hirnverbrannten christlichen Freunde erzählen, von ewiger Glückseligkeit und so, dann läuft es mir kalt den Rücken hinunter. Das wäre ja grauenhaft! Nicht einmal meinem ärgsten Feind würde ich ewige Glückseligkeit wünschen. Und doch: Heute werden die Leute achtzig, neunzig, hundert Jahre alt, und selbst das reicht nicht, um sie zur Verantwortung zu ziehen für das, was sie in ihrem Leben angerichtet haben. Hier sind wir und zerstören unseren Planeten.
Liegt den Menschen Krieg im Blut?
Die Menschen sind harmoniebedürftig, aber dumm und gierig. Ich habe einmal ein Gedicht geschrieben mit dem Titel «The Hubble Telescope». Es ging ungefähr so: Es war einmal, da gab es nichts. Es gab nicht einmal einmal oder nichts. Dann kam der grosse Big Bang, und plötzlich war all die Scheisse da.
Sie klingen wie jene Christen, die sich derzeit für «intelligent design» einsetzen, eine Art wissenschaftliche Schöpfungsgeschichte.Nein, mit diesen religiösen Fundamentalisten habe ich nichts zu tun. Ich möchte junge Leute nur dazu ermutigen zu sehen, was für ein Wunder das menschliche Leben ist. Wie wunderschön es gemacht ist. Dass wir es schätzen und beschützen sollten. Erst wenn wir den Wert des menschlichen Lebens wirklich erkannt haben, werden wir beginnen, uns gegenseitig anständig zu behandeln. Das menschliche Leben ist das Heiligste, was es gibt.
tankwarth - 8. Mär, 16:56
Vielleicht ist es so? Die Jugend ist heute umzingelt von Techno hörenden Vätern, kiffenden Tanten, Mountainbike fahrenden Rentnern und easy Lehrern mit farbigen Rucksäcken und den gleichen Turnschuhen wie sie selber. Ihr Wunsch ist es, beim Jungsein von den Erwachsenen in Ruhe gelassen zu werden. Und ihnen stattdessen beim Erwachsensein zuschauen zu können.
tankwarth - 8. Mär, 16:50
Von Markus Schär
Wer es zu etwas bringen will, zieht in die Stadt, also vorwiegend nach Zürich. Der Provinz fehlen durch diesen Brain-Drain ihre hellsten Köpfe. Die Weltwoche zeigt erstmals für alle Kantone das Kommen und Gehen der Hirnmassen.
Anzeige
Wenn eine der berüchtigtsten Streberklassen der Kanti Frauenfeld das 30-Jahr-Jubiläum ihrer Matur begeht, kehren sie vielleicht wieder einmal in den Thurgau zurück. Marianne, die Schwester des bekannten Financiers aus der Mostereidynastie, flüchtete gleich nach der Schule aus dem Kanton und führt jetzt eine Praxis als Psychoanalytikerin in Bern. Roman betreibt nach befristeten Professuren in Illinois und an der ETH das Geschäft mit seiner Programmiersprache im steuergünstigen Wollerau. Und Peter erfuhr nur Missgunst, als er eine der Traditionsfirmen von Frauenfeld rettete; der lokale Lions Club nahm das aus Deutschland zurückgekehrte Mitglied erst nach einem erneuten Verfahren auf: Die Unternehmen, die sich wieder zur Blüte führen lassen, sucht er jetzt von Zürich aus.
Was soll ein Börsianer in Uri?
Acht von dreizehn, die es in meiner Klasse bis zur Matur schafften, wanderten aus dem Thurgau ab. Zu den vier, die neben mir als Berufspendler noch im Kanton leben, gehört Hans: Der Sohn des FDP-Ständerats und Saurer-Verwaltungsratspräsidenten amtet als Bezirksgerichtspräsident, führt die freisinnige Fraktion im Kantonsparlament und betreibt daneben eine Anwaltskanzlei, wie das 250 Jahre nach der Erfindung der Gewaltentrennung in unserem Kanton möglich ist. Und Wilfried, unser gescheitester Kopf: Er bildete sich in Zürich zum Landpfarrer aus, sorgte für die Seelen in einem Bauerndorf und in einem Vorort und leitet jetzt den Kirchenrat. «Ja, ich bin ein Eingeborener, der es geografisch nicht weit gebracht hat», sagte er in einem Porträt im Lokalblatt. «Aber die Weite des Geistes holt man sich nicht nur auf einer Weltreise.»
Was meine Kantiklasse verkörpert, heisst auf Neudeutsch Brain-Drain. Und gilt als Problem: Das Hirn fliesst aus der Provinz ab, die Zentren ziehen die grauen Zellen an. Darunter leidet nicht nur der Thurgau, für den die Universität St.Gallen kürzlich eine Studie zur «Förderung wissensintensiver und wertschöpfungsstarker Unternehmen» erstellt hat. Als Problem erkennen es auch die Urner: In einem Regionalentwicklungsprogramm, für das die EU (!) bezahlt, denken sie über Massnahmen zum Brain-Gain nach; sie fragen sich also, wie sich verlorene Spitzenkräfte wieder in den Kanton locken liessen. Die Walliser: Sie stellten 2004 eine Studie vor, die den beunruhigenden Verlust von Akademikern aufzeigt. Und die Vertreter der Berggebiete insgesamt: Sie warnten schon 2003 mit dem Bericht «Brain Drain in der Schweiz», die Berggebiete verlören ihre hochqualifizierte Bevölkerung. Die Zahlen zur Abwanderung von Akademikern, die das Bundesamt für Statistik für die Weltwoche erstmals ausgewertet hat, bestätigen diesen Befund – auch für Landstriche mit lieblicherer Topografie.
Ist das Abwandern der Spitzenkräfte in die Zentren aber tatsächlich ein Problem für die Schweiz? Und wenn ja: Wer ist das grössere Problem für die Provinzkantone – die Akademiker, die abwandern, oder jene, die zurückkehren?
Es ist wünschbar, dass die Städte die hellen Köpfe anziehen, also in der Schweiz vor allem Zürich: Dorthin ziehen 30 Prozent der Thurgauer Akademiker, vom Zukunftsforscher David Bosshart über die Moderatorin Mona Vetsch bis zum Autor Peter Stamm. Das ist Rekord, aber auch Schaffhausen (29 %), Uri (27 %), St.Gallen (25 %) oder der Aargau (21 %) verlieren einen bedeutenden Teil ihrer gebildeten Jugend an Downtown Switzerland. Sogar aus Basel ziehen 10 Prozent der Akademiker nach Zürich, wie der Anwalt und Nationalrat Daniel Vischer oder der Historiker Philipp Sarasin – eine Bewegung in der Gegenrichtung lässt sich nicht messen.
«Die Schweiz braucht Zürich als starkes Zentrum, also mehr Konzentration und weniger Ausgleich», sagt Thomas Held, der mit dem Think-Tank Avenir Suisse gegen den helvetischen Kantönligeist kämpft. Dem Zustrom von aufgeschlossenen, unternehmerischen Köpfen verdankt Zürich seit Jahrhunderten seine Blüte: Schon Zwingli kam aus dem Toggenburg, die Pestalozzi, Orelli und von Muralt(o) stammen als Glaubensflüchtlinge aus Locarno, und Otto Coninx zog sogar aus dem Ruhrgebiet nach Zürich, um den Tages-Anzeiger zu gründen. Der Chefredaktor des Leibblatts der Zürcher kommt aus Schaffhausen (und wohnt noch dort), jener des Blicks, ebenfalls als Pendler, aus Olten und jener der NZZ aus Zug.
Und nicht nur die Medienhauptstadt der Schweiz lebt, weil sie frisches Blut aus der Provinz abzapft; auch die Beratungsfirmen, die Unterhaltungsbranche, die Informatikdienstleister und vor allem der Finanzplatz blühen nur, weil sich die Talente in Clustern verklumpen. St.Gallen eigne sich nur für Familienväter wie ihn als Arbeitsplatz, lacht Pierin Vincenz, der Chef der Raiffeisenbanken. Für die Leute, die er beim Börsengeschäft dringend brauchte, musste er einen Ableger in Zürich aufbauen: «Nach St.Gallen bringen Sie niemanden – abends um acht Uhr ist die Stadt tot.»
Die Abwanderung der Spitzenkräfte lässt sich also nicht aufhalten – sie ist eher noch zu fördern. Nur wenn die Schweiz ihr Talent in der Metropole zusammenballt, meint Thomas Held, kann Zürich mit seiner wahren Konkurrenz mithalten: nicht Basel oder Bern, sondern München und Mailand. Aber könnte, wer im internationalen Standortwettbewerb für Downtown Switzerland kämpft, wenigstens in der Provinz wohnen bleiben?
Das Team von HSG-Professor Thomas Bieger, welches die Studie für den Thurgau erstellte, empfiehlt dem Kanton, sich als «Goldküste Nord» anzupreisen: Tatsächlich lockt vor allem der Untersee mit attraktivem Lebensraum und passablen Verkehrsverbindungen; in Romanshorn oder Arbon am Bodensee bieten sich leerstehende Industriebauten für grosszügige Lofts am Wasser an. Begleitende Angebote wie Bildungsgutscheine, Frühenglisch, Tagesschulen oder eine spezielle Vermittlungsagentur für hochqualifizierte Arbeitskräfte und den Wiedereinstieg für Frauen sollen das Wohnen für Familien im Thurgau attraktiv machen. Dazu seien auch Flächen auszuscheiden, «wo nur ein absolutes Minimum an Bauvorschriften die Vorstellungen der Kunden einschränkt bzw. wo nur ausgefallene Bauten realisiert werden dürfen, welche überregionale Aufmerksamkeit für die Aufgeschlossenheit und Qualität des Kantons erzeugen».
Heimattreue Regierungen und Banken
Dafür bieten sich auch schöne Landstriche in anderen Kantonen an, etwa am Ägerisee, rund um den Vierwaldstättersee oder am Wasser im Grenzgebiet von Aargau und Luzern, wo tatsächlich schon ein Bauboom herrscht. Aber ist das Anziehen von schlafenden, segelnden und allenfalls Schulen benutzenden Bürgern die Lösung für diese Kantone? Die Experten, auch Thomas Bieger selber, geben sich skeptisch: Für Double Career Couples, bei denen Frau und Mann zur Arbeit pendeln, liegen diese Wohngebiete letztlich doch zu weit von den Zentren entfernt. Die Regionen, die unter der Abwanderung leiden, können sich nur entwickeln, wenn sie selber Arbeitsplätze für Hochqualifizierte anbieten.
Dafür müssten die Kantonspolitiker sorgen – aber sie sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Bei den Zahlen, die das Bundesamt für Statistik für die Weltwoche ausgewertet hat, fällt eines auf: Die Juristen haben um bis zu 25 Prozentpunkte höhere Rückkehrerquoten als die Akademiker insgesamt. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn im Gegensatz zu Ingenieuren oder Designerinnen gibt es überall Bedarf an Rechtsgelehrten, in der Justiz natürlich, aber auch in der Politik und beim Staat, also in seiner Verwaltung und seinen Betrieben. Letztlich bedeutet das: Die innovativen und kreativen Köpfe müssen in die Welt hinaus ziehen; die Juristen aber, die in ihre Kantone zurückkehren, ohne mehr als ihre Universitätsstadt gesehen zu haben, schotten ihr traditionelles Hoheitsgebiet ab.
So schmoren einige Kantonsregierungen im eigenen Saft. In Graubünden sitzen im Regierungsrat vier Anwälte und ein Bauingenieur, alle gebürtig aus dem Kanton. In Uri werben sieben Einheimische um Rückkehrer – nur die Politologin Heidi Z’graggen hat vorher ausserhalb des engen Tals gearbeitet. In Glarus, mit drei Lehrern, haben sich allein die Anwältin Marianne Dürst-Kundert, die als Flight Attendant jobbte, und der Ökonom Rolf Widmer, der auch in Oxford lernte und in St.Gallen lehrt, in die Welt hinausgewagt.
Im Thurgau bilden derzeit drei Verbindungsbrüder des Frauenfelder Studentenvereins Concordia die absolute Mehrheit. Philipp Stähelin, der als Verbindungsbruder, Anwalt und Artillerieoberst die Karriereleiter vom Departementssekretär bis zum Ständerat hochstieg, regierte als Finanzdirektor im Thurgau so souverän wie niemand seit seinem Vater (von 1935 bis 1968) – über den Präsidenten der CVP Schweiz lächelte das Land, wenn es ihn überhaupt zur Kenntnis nahm.
Denn wer sich intern nicht im Wettbewerb bewähren muss, der verliert extern die Wettbewerbsfähigkeit. Das zeigt sich besonders deutlich und bedrohlich bei den Bollwerken der Staatswirtschaft, den Kantonalbanken. Die meisten von ihnen sind fest in der Hand der lokalen Classe politique. Im Thurgau rückt voraussichtlich ein mehrfach verschmähter Regierungsratskandidat und gescheiterter Stadtammann der übermächtigen SVP, der seither lukrative Beratermandate vom Staat bekam, ins Präsidium auf. In Nidwalden «ist die Verflechtung mit der Politik ungewöhnlich stark», in Glarus «waren alle neun Bankräte per 1. Januar 2004 entweder (alt) Landrat, Landstatthalter oder Regierungsrat», wie Maurice Pedergnana und Daniel Piazza in ihrer aufschlussreichen Studie «Kantonalbanken im Vergleich 2004» feststellen.
Der Verwaltungsrat der Walliser Kantonalbank «weist ein verbesserungsfähiges Profil in der Altersstruktur und an spezifisch bankwirtschaftlichen Kenntnissen aus; die einzelnen Mitglieder sind in derart vielen weiteren Verwaltungsräten engagiert, dass die Unabhängigkeit des Gremiums genau verfolgt werden muss». Und die Tessiner Kantonalbank, seit letztem Jahr unter dem Präsidium von Fulvio Pelli, gilt ein paar freisinnigen Anwaltsdynastien als Privatangelegenheit. Sie müsse dringend versuchen, mahnen die Autoren, «ihre Corporate Governance und Political Governance zu verbessern bzw. zwingend lernen, sich den politischen Einzelinteressen zu widersetzen».
Mauscheln im Kreis der Eingeborenen
Die öffentliche Hand liebe den Wettbewerb um ihre Aufträge nicht, klagt der eingewanderte Churer Verleger Hanspeter Lebrument: «Graubünden, das in einem wachstumsarmen Land einer der wachstumsschwächsten Kantone ist, versucht, so wenig wie möglich Aufträge dem Submissionsgesetz zu unterstellen.» Denn so lasse sich einfacher im Kreis der Eingeborenen mauscheln: «Der Wettbewerb wird an verschiedenen Stellen der öffentlichen Hand verhindert, weil individuelles Wohl vor Allgemeinwohl gesetzt wird.» Auch die Studie zum Brain-Drain aus dem Wallis fordert weniger Vetternwirtschaft und weniger Kirchturmpolitik: «Der Einfluss der Politik auf den Alltag im Wallis wird von den Befragten häufig als Problem wahrgenommen.»
Die Kantonspolitiker, die den Markt behindern, sollen also im Wettbewerb der Standorte ihre abgewanderten Spitzenkräfte zurücklocken. Dafür verlangen sie mehr Staat: «Ein gut funktionierender Service public ist die zentrale Voraussetzung, damit Leben und Wirtschaften im Berggebiet weiterhin möglich ist», hält die Studie «Brain Drain in der Schweiz» fest. Und die staatsnahen Unternehmen müssen von Gesetzes wegen an der Peripherie Arbeitsplätze schaffen, wie das Postfinance-Verarbeitungszentrum in Netstal GL oder das SBB Contact Center in Brig, den «virtuellen Hauptbahnhof der Schweiz». Die Oberwalliser haben überhaupt erkannt, dass dank dem weltweiten Netz Abgeschiedenheit (die sie als jene der «Üsserschwyz» wahrnehmen) kein Nachteil zu sein braucht: Brig ist auch der Sitz der Fernuniversität und der Fernfachhochschule.
Selbstbewusstsein als Staatsaufgabe?
Nur Unternehmen schaffen aber letztlich Arbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung: Da stimmen alle Studien überein – und bei der Frage, wie die Unternehmer zurückzuholen wären, zeigen sich alle gleich ratlos. Die staatliche Wirtschaftsförderung soll es richten, also «in einem partizipativen Prozess Strategien zur Förderung von Brain Gain entwickeln» (Uri), «mehr Wachstumschancen aus der Kooperation zwischen Wirtschaft und öffentlicher Hand erarbeiten» (Thurgau) oder sogar «den Unternehmergeist und ein grösseres Selbstbewusstsein fördern» (Wallis). Aus allen verklausulierten Formeln der Standortförderer spricht eine Erkenntnis: Im Land liesse sich gut leben – wenn die Leute nicht so wären, wie sie sind.
Was soll ich also meinen Schulkollegen beim Klassentreffen sagen? Weshalb wohne ich immer noch im Thurgau, obwohl mich fast gar nicht mehr kümmert (und ärgert), was im Kanton und in der Gemeinde geschieht? Der Thurgau bietet, wie die meisten Regionen, die unter Brain-Drain leiden, tatsächlich Lebensqualität: Bei Sonnenaufgang im Bodensee schwimmen, in der Kartause Ittingen die Mönchsgesänge des Hilliard Ensemble hören, in einer Gartenbeiz den Pinot Noir von Hansueli Kesselring trinken – hier lässt es sich aushalten.
Ich wohne gleich neben dem Bahnhof. Der Schnellzug nach Zürich fährt jetzt jede halbe Stunde.
Literatur:
Brain Drain in der Schweiz. Die Berggebiete verlieren ihre hochqualifizierte Bevölkerung; auf der Website der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für Berggebiete www.sab.ch
Wegziehen – Bleiben – Zurückkehren. Eine wissenschaftliche Studie der Arbeitsmarktbeobachtung Wallis zur Abwanderung von Kompetenzen von Walliserinnen und Wallisern; auf der Website des Kantons Wallis
Strategien und Massnahmen zur Förderung wissensintensiver und wertschöpfungsstarker Unternehmen im Thurgau; auf der Website www.thinktankthurgau.ch
Markus Schär: O Thurgau. Ein Kantonsführer für Fortgeschrittene.
O Thurgau Verlag, 2002. 430 S., Fr. 36.–
Zusatzinfos: Teil 1, Teil 2
tankwarth - 4. Mär, 19:02
Von Beatrice Schlag
Schweizer haben kein Herz für Schweizerinnen, fast jeder dritte heiratet eine Ausländerin. Stichwort Ausländerin: Was haben sie, was einheimische Frauen nicht haben? Wenn Alleinsein der Preis der Emanzipation ist – dann gute Nacht.
Anzeige
Die Frauen haben sich emanzipiert, und alle applaudieren. Vor allem ihre einstigen Vorgesetzten, die Männer. Ihr seid, sagen sie, das kommende Geschlecht. Die Zukunft gehört euch. Ähnlich ungeteilten Beifall bekam in den letzten Jahrzehnten nur die Anti-Apartheid-Bewegung. Aber wer denkt heute an Südafrika, wenn er sagt, die Zukunft ist schwarz?
Nein, keine Parallelen. Die Frage ist: Wo genau haben Frauen gewonnen? Studie um Studie wird ihnen attestiert, sie seien das zukunftstauglichere Geschlecht: teamfähiger, innovativer, pragmatischer und konfliktfähiger als Männer. «Die Leitfigur des 21. Jahrhunderts», schrieb das Gottlieb-Duttweiler-Institut im letzten Jahr, «ist die starke, unabhängige Frau, die auf ihre eigenen Kräfte vertraut und ihre eigenen Ziele verfolgt.» Ein «Megatrend Frau» wurde erspäht, Zukunftsforscher Matthias Horx rief das Jahrhundert der Frau aus.
Aber das neue Jahrtausend liess sich genau so an, wie das alte zu Ende gegangen war: mit einer beeindruckenden Sesshaftigkeit der Männer. 53 Prozent der Schweizer Wahlberechtigten sind Frauen, über 75 Prozent der Politiker sind Männer. Die Frauen stellen 45 Prozent der Erwerbstätigen, aber in den höheren Kadern sitzen mehr als 90 Prozent Männer. Die Hand voll Managerinnen, die es in die Spitzenetagen schaffen, werden von den Medien gefeiert wie Pandabären, denen die Fortpflanzung geglückt ist. Carly Fiorina! Miuccia Prada! Barbara Kux! Falls einem ausser dem von Fernsehdirektorin Ingrid Deltenre kein Name einer einheimischen Spitzenmanagerin einfällt, dann deswegen, weil es sie kaum gibt. In den Geschäftsleitungen börsenkotierter Schweizer Firmen sitzen drei Prozent Frauen.
Was hilft es, dass inzwischen gleich viele Frauen wie Männer einen Universitätsabschluss haben? Die Löhne für weibliche Angestellte sind noch immer durchschnittlich zwanzig Prozent unter denen, die Männer für die gleiche Arbeit erhalten. Und die Rate der Väter, die Teilzeitarbeit leisten wollen und dank einsichtiger Arbeitgeber auch können, liegt seit Jahren unverändert unter zehn Prozent. Die Misere mit den Krippenplätzen hält an. «Der Stand der Gleichstellung in der Schweiz ist, verglichen mit den 15 EU-Staaten, nicht sehr weit fortgeschritten», konstatiert das Bundesamt für Statistik. Nicht sehr weit fortgeschritten? Nach dem Beginn der ziemlich lauten Frauenbewegung der sechziger Jahre scheint sich heute kaum noch etwas zu bewegen. Haben Zyniker Recht, die sagen, die beste Taktik, Frauen von der Macht fern zu halten, sei, ihnen ständig zu versichern, sie hätten den Geschlechterkampf gewonnen?
Es gibt eine Ebene, auf der die Frauen gewonnen haben. Es war nicht, was sie im Sinn hatten. Unerwartet tat sich ein Weg auf, der im Gegensatz zum langen Marsch Richtung öffentliche Gleichstellung ziemlich unmittelbar zum Erfolg führte: der Angriff auf die maskulinen Weichteile, die Demontage des männlichen Selbstbewusstseins im Privatleben. Das war am Anfang mehr Notwehr als Absicht. Inzwischen ist es ein Desaster.
Eine Kurze Rückblende: Der Slogan der Achtundsechziger «Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment» war für Frauen eine völlige Überforderung. Die wenigsten der Protestlerinnen waren promisk. Aber sie verrenkten sich die Herzen, um nicht als besitzergreifend zu gelten, wenn ihre Männer fremdgingen. Besitzergreifend war ein Schimpfwort, das exklusiv auf Frauen angewandt wurde. Die Frauen litten wie Hunde, weil sie einsahen, dass der Mensch teilen soll, was gut ist, also auch den Liebsten.
Ausserdem waren sie zu begierig, den Männern mit progressiver Unverklemmtheit zu imponieren, um den Satz als das zu erkennen, was er war: ein sexueller Bubentraum, verpackt in eine saloppe politische Provokation. Die Männer kamen denn auch mit der plötzlich angesagten Promiskuität sehr viel besser zurecht. Frauen hatten noch keine Übung, Sex und Gefühle zu trennen, als der sogenannte Geschlechtsverkehr mit häufig wechselnden Partnern ein paar Jahre lang zur Verhaltensnorm wurde. Wenige hatten den Mut zu sagen, dass es ihnen keine Freude machte. Frauen wollten hören, warum ein Mann mit ihnen, genau mit ihnen und nur mit ihnen schlafen will.
Versuchsweise am Penis kritteln
Aber was Frauen wollten, war zweitrangig, im Bett wie auf den Barrikaden. Zwar widersprach kaum ein Achtundsechziger ernsthaft, wenn die Genossinnen sich über ihre wirtschaftliche und gesellschaftliche Benachteiligung beklagten. Aber sie hörten nur mit halbem Ohr hin, denn die Frauenfrage war nur ein Nebenwiderspruch in der grossen Auseinandersetzung zwischen Arbeit und Kapital. Klingt heute absurd, aber so redeten sie daher, nächtelang. Das Wort «Nebenwiderspruch» nagt an einem. Wenigstens einen Hauptwiderspruch sollte das eigene Geschlecht hergeben, wenn man kein Stimmrecht hat, neben der Arbeit den ganzen Haushalt macht und in der Zeit, die bleibt, die Welt zu verändern versucht.
Die frecheren Frauen begannen versuchsweise, am Penis zu kritteln. Denn Sex war ein sprödes, kurzes Verkehren, bei dem die Männer meist zum Orgasmus kamen und die Frauen selten. Männer wussten kaum etwas von Frauenkörpern. Umgekehrt auch nicht, nur lässt sich der männliche Körper durch unkundige Handhabung nicht so leicht irritieren wie der weibliche. Nicht die Schuld der Männer. Von der Existenz des Winzteils namens Klitoris hatten den meisten weder Eltern noch Biologielehrer erzählt. Den Frauen auch nicht, aber eine zu haben, verschaffte praktischen Wissensvorsprung. Es gab Möglichkeiten, satt zu werden, und die Männer liessen einen trotzdem verhungern.
In der Sexualität tat sich die Goldgrube der weiblichen Emanzipation auf. Die Frauen verbargen ihre Unbefriedigtheit zunehmend weniger und lernten: Indem man seine sexuelle Leistung anzweifelt, kann man den Mann abholen. Und wie man ihn abholen kann. Ein enttäuschter Blick nach dem Erreichen des Gipfels, wo er allein einen Wimpel steckte, und man brach sein Kreuz. Nicht nur im Bett. Einmal angeknackst, schien er eine einzige Knickfläche zu werden. Der angezweifelte Mann wurde bereit, im Sitzen zu pinkeln, Gebärkurse mit zu besuchen und ein schlechtes Gewissen zu bekommen, wenn ihn unter T-Shirts schaukelnde Brüste mehr interessierten als innere Werte. Also immer.
Es war sehr erfreulich, das zu beobachten. Man brauchte nur «Macho» oder «Chauvi» zu sagen, und sie ergingen sich in Erklärungen. Es war so neu, die Frauen konnten nicht genug davon bekommen. Sie verkündeten, Penetration sei ein nicht länger hinzunehmender Gewaltakt der Unterwerfung, und hofften, die Männer würden sie auslachen. Denn was fängt man sonst im Bett miteinander an? So viel Erfahrung hatten Frauen nicht in Lust, dass sie mit frohen Alternativen hätten überraschen können. Der Anti-Penetrations-Fimmel war denn auch die kurzlebigste ideologische Verirrung der Feministinnen. Er scheiterte kläglich am beiderseitigen praktischen Begehren. Aber in den Köpfen der Männer richtete er bleibende Zweifel an.
Männer sind Mimosen
Dann kam die politische Korrektheit, die linguistische Tilgung der sozialen Diskriminierung von Frauen, Farbigen, Schwulen, Behinderten, Kleinwüchsigen und Übergewichtigen. Anfänglich als hysterischer Scherz aus den USA verspottet, schlich sie sich dauerhaft auch in europäische Sprachregelungen und verstärkte die männlichen Zweifel. Auf die politische folgte die sexuelle Korrektheit. 1993 verfasste das Antioch College in Ohio einen Code für sexuelle Umgangsformen, um die angeblich alarmierenden Vergewaltigungszahlen auf dem Campus zu senken. Der Code besagte im Wesentlichen, dass an keiner Bluse, an keinem Reissverschluss genestelt werden darf, ehe der Nestler nicht ausdrücklich verbale Erlaubnis eingefordert hat. Das europäische Gelächter war noch grösser und ungläubiger als bei der politischen Korrektheit. Inzwischen erlässt fast jede einheimische Firma Richtlinien für sexuell korrekten Umgang am Arbeitsplatz, die nicht sehr weit von dem Campus-Knigge entfernt sind. Die sexuelle Korrektheit zementierte die Frau in ihrer ältesten und langweiligsten Rolle: der des Opfers. Natürlich galten und gelten die Verhaltensregeln für beide Geschlechter, aber wer der potenzielle Schweinehund ist und wem Gewalt angetan wird, war immer klar. Ein Vierteljahrhundert nach ihrem Beginn hatte sich die Frauenbewegung in eine Sackgasse manövriert, in der sie noch heute steckt. Nicht zuletzt, weil sich darin viele Frauen bequem eingerichtet haben. Opfer haben immer Recht.
Das ist keine auch nur annähernde Zusammenfassung des Feminismus, der Frauen Chancen gegeben hat, die sie nie zuvor hatten, und Männern auch. Es ist der Versuch zu verstehen, wie es im Lauf einer Bewegung, die das Selbstverständnis beider Geschlechter bis zur totalen Verwirrung umkrempelte, die Frauen im Privaten schafften, was ihnen bis heute weder in der Arbeitswelt noch in der Politik gelungen ist: sich den Männern gegenüber zu behaupten. Und manche von ihnen bis zur Grimmigkeit zu verunsichern. «Die Denunziation», sagt der Zürcher Psychoanalytiker Markus Fäh, «fand nicht im öffentlichen, sondern im seelisch-sexuellen Bereich statt. Diese Verhöhnungsschiene ist tödlich. Männer sind Mimosen.»
Richtig. Nur waren sie ein paar Jahrtausende lang im Austeilen nicht zimperlich gewesen. Jetzt war Zahltag. Wenn Frauen untereinander über Männer redeten, schwankte der Ton zwischen Wut, Spott und Verachtung. Diese Wehleidigkeit! Diese Aufgeblasenheit! Diese Unfähigkeit, ein Emotiönchen zu zeigen! Zunehmend redeten sie nicht nur untereinander, sondern auch mit Männern so: Ihr Gefühls-krüppel. Ihr stupiden Macker. Ihr Vergewaltiger. Es traf die Männer ungleich härter, als sie sich anmerken liessen. Und es prägte die Kinder der Feministinnen. Die Mädchen wurden selbstbewusster, fordernder als die Mütter, Gott sei Dank, die Buben zögerlicher. Sie wurden mit einem diffusen Schuldgefühl gross, Buben zu sein.
Heute sind die Buben zwischen dreissig und vierzig und haben genug davon, sich schuldig zu fühlen, weil sie Männer sind. Sie sagen das selten so direkt. Man hört ihren Groll in Nebensätzen, bei Gesprächen im Tram, unter Freunden, am Nebentisch im Restaurant, was wenig repräsentativ sein mag. Aber er lässt sich auch in einer bundesamtlichen Statistik nachlesen, die unbestreitbar repräsentativ ist: Bald jeder dritte Schweizer heiratet eine Ausländerin, Tendenz steil ansteigend. Vor acht Jahren war es noch jeder vierte, vor zwölf jeder fünfte.
Die Neigung der Schweizerinnen zum ausländischen Ehemann ist ebenfalls gestiegen, aber deutlich weniger ausgeprägt. Nicht einmal jede vierte heiratet einen Mann aus einem andern Land, obwohl in der Schweiz mehr Ausländer leben als Ausländerinnen. Vor acht Jahren war es jede siebte, vor zwölf jede achte. Ihre Chance auf langes Glück mit einem Ausländer ist auch nicht besonders gut: Die Scheidungsrate bei Ehen zwischen Schweizerinnen und Ausländern beträgt über 45 Prozent, diejenige zwischen Schweizern und Ausländerinnen hingegen sensationell tiefe 30 Prozent. Der Durchschnitt aller in der Schweiz geschiedenen Ehen liegt bei 41 Prozent.
Das sind beachtliche Zahlen. Zum Vergleich: In Deutschland sind lediglich vier Prozent der Einheimischen mit Ausländern verheiratet, deutsche Frauen etwas häufiger als deutsche Männer. In Frankreich ist immerhin jede fünfte Ehe binational; die Zahl der Französinnen mit ausländischen Partnern liegt fast ein Drittel höher als die der Franzosen. Aber so häufig wie in der Schweiz sind Mischehen nirgends in Europa. Das Beruhigende daran ist, dass wir trotz unseres Unwillens an der Urne, Ausländer einzubürgern, offenbar sehr ausländerfreundlich sind. Gleichzeitig besagt die eheliche Globalisierungsfreude etwas überhaupt nicht Beruhigendes : Schweizerinnen und Schweizer können immer weniger miteinander anfangen.
Zu diesem Schluss kommt unausweichlich, wer die Nationalitäten der ausländischen Ehepartner vergleicht. Schweizer heiraten vorwiegend Brasilianerinnen, Thailänderinnen, Afrikanerinnen und Kubanerinnen; wenn Europäerinnen, dann mit Vorliebe aus dem Osten – die besonders gefragten Russinnen werden in der Statistik unter «Europa» aufgeführt. Der Schweizerinnen liebste ausländische Ehemänner hingegen sind die Italiener, gefolgt von anderen Westeuropäern. Ehepartner aus Lateinamerika, Asien und Afrika sind nicht halb so begehrt wie bei den Schweizern.
Das erzählt von Sehnsüchten, die nichts mehr miteinander zu tun haben. Warum bevorzugen die Frauen Europäer mit vergleichbaren Kulturen und die Männer Frauen aus fernen Ländern und Kontinenten? Keine Studie hilft weiter.
Wer putzt? Wer kauft ein?
Nachfragen bei Gleichstellungsbüro, Mannebüro, Fraueninformationsbüro, IG Binational und anderen Expertenstellen für zwischengeschlechtliche Begegnungsprobleme ergeben durchwegs die gleiche Antwort: «Hochinteressantes Thema, ja, wir kennen die Daten. Aber wir haben keine Untersuchungen und können über Gründe nur spekulieren.» Also keine offiziellen Stellungnahmen. Inoffiziell sind die Gespräche lang und differenziert. Keine Vorurteile, keine «Männer-wollen-halt-Exotinnen»-Klischees. Ja, es gibt Schweizer, die junge Frauen aus Asien, Afrika oder Lateinamerika finanzieren und abhängig halten, weil sie daheim niemals eine junge bekommen würden. Und es gibt Scheinehen und Missbrauch.
Aber der zentrale Punkt, sagen alle, ist ein anderer: Schweizerinnen sind vielen Schweizern zu streng und zu anstrengend geworden. Was einmal Frauensache war, muss heute im Zusammenleben zäh ausgehandelt werden. Wer darf wie viel Karriere machen, wer den Abendkurs, wer putzt, wer kauft ein, wer bringt die Kinder in den Hort? Das Ringen um Gleichstellung in der Partnerschaft hat die Frauen nicht weicher und die Männer nicht glücklicher gemacht. «Man hat sich entfremdet», sagt eine der Befragten, «die Frauen sind nicht mehr wie die Mütter, mit deren Bild die Männer aufgewachsen sind. Der Zugang zu den Fremden ist heute nicht mehr fremder als der zu den einheimischen Frauen. Viele Männer möchten eine Frau gerne umsorgen. Aber das lassen Schweizerinnen nicht mehr zu.»
Aussereuropäische Ausländerinnen, sagen alle, hadern selten mit ihrem Frausein. Sie lassen den Mann nicht nur Mann sein, sie fördern seine Männlichkeit und streichen ihre Weiblichkeit heraus. Und, nicht zu vergessen, sie machen in den meisten Fällen den Haushalt, ohne sich deswegen minderwertig zu fühlen. Einer der Befragten lacht. «Ihr habt das Patriarchat unterschätzt. Es lässt sich nicht kleinkriegen. Es bewegt sich einfach seitwärts.»
Ungebrochene Weiblichkeit
Der 39-jährige Geologe Rolf, der seit fünf Jahren mit einer Ghanaerin verheiratet ist und mit ihr zwei Kinder hat, war mit zwei Schweizerinnen länger zusammen, bevor er aus Arbeitsgründen nach Afrika ging. «Die erste war eine enorme Nörglerin. Im Haushalt machte ich zu wenig oder alles falsch. Ich hatte das Gefühl, sie wolle lieber nörgeln, als mir Zeit zu lassen, bis ich es besser kann. Die zweite hatte ständig Angst, übervorteilt zu werden, selbst wenn es darum ging, in welches Kino man will. Wenn wir uns zweimal in der Woche sahen, fühlte sie sich bereits eingeengt. Sex war immer mit Problematisieren verbunden.»
Während seiner Arbeit in Afrika lernte er seine Frau kennen, eine ausgebildete Hotelfachfrau. «Florence war selbstbewusst und hatte ein absolut ungebrochenes Verhältnis zu ihrer Weiblichkeit. Der Sex ist nicht wild, ich lernte keine neuen Praktiken. Aber er war plötzlich einfach. Wenn man Hunger hat, sagt sie, muss man essen. Es ist keine Psychologie dahinter.»
Da Florence in Afrika keine Arbeit fand, kamen sie in die Schweiz. Sie heirateten der Papiere wegen, aber nicht nur. Sie wollten Kinder. «Die Ehe hat in Afrika den Wert einer Institution», sagt Rolf, «es gibt eine Ebene, die auch bei grössten Krächen nicht tangiert wird. Den Ausweg, notfalls kann man sich scheiden lassen, gibt es nicht. Da entwickelt man ganz neue Energien, Konflikte zu lösen. Das kam von ihr, und es berührt mich. Es gibt mir das Gefühl, es gebe in meinem Leben etwas Bedingungsloses, etwas, was nicht dem Leistungsprinzip unterworfen ist.»
Dass seine Frau, wie fast alle Frauen der für diese Geschichte befragten Männer, allein den Haushalt macht, wischt er als eher unwichtig vom Tisch. Es ist alles andere als unwichtig. In einer Umfrage vom letzten Jahr äusserten sich Schweizer Paare mit traditioneller Aufteilung von Haus- und Berufsarbeit sehr zufrieden über ihr Zusammenleben. Die unzufriedensten Paare hingegen waren jene mit der egalitärsten Aufteilung von Beruf, Haushalt und Kinderbetreuung. Die Ausmarchungen, wer was übernimmt, sind steter Anlass für Konflikte. Laut Statistik arbeiten Mann und Frau in der Schweiz, wenn man bezahlte und unbezahlte Arbeit zusammenrechnet, ziemlich genau gleich viel. Im Haushalt allerdings arbeiten Frauen durchschnittlich 31 Stunden und Männer nur 17, dafür haben Männer häufiger 100-Prozent-Jobs. Nicht faul oder fleissig ist die Frage, sondern wer was macht. Die meisten Schweizerinnen würden lieber länger ins Büro gehen und weniger Haushalt am Hals haben. Aber sobald Kinder da sind, haben sie darauf kaum noch Aussichten. Der Arbeitsmarkt bietet Teilzeitjobs für Frauen, aber kaum für Männer.
Jan, 33, hat vor einem Jahr eine Russin geheiratet. Er ist Event-Manager, sehr erfolgreich, sehr gestresst. Seine Beziehungen zu Schweizerinnen waren alle nicht dauerhaft. «Sie sind mir zu egoistisch», sagt er. Dann korrigiert er: «Sie sind so egoistisch wie ich auch. Wir waren zu gleich. Gleich ehrgeizig, gleich tough, gleich entschlossen, dem andern kein Terrain abzutreten. Das war das Fade. Man will doch abends nicht dasselbe zu Hause haben, was man selber ist.» Nachdem er Nina kennen gelernt hatte, pendelte sie zwei Jahre mit Touristenvisum zwischen Russland und der Schweiz. Die Einwände seiner Freunde gegen eine Heirat – Die schröpft dich! Das kannst du hier billiger haben! – waren so heftig wie seine eigenen Zweifel. Er hatte nie heiraten wollen. Nina war 27, unverschämt gutaussehend und machte sehr klar, dass sie einen Ehemann suchte, um aus Russland wegzukommen. Sie sagte auch, sie sei zu alt, um lange herumzutändeln. Entweder er heirate sie, oder sie sehe sich nach einem andern um.
«Das gefiel mir», sagt er, «es lag immer alles auf dem Tisch. Sie machte sich nie klein, sie spielte nicht die Verliebte. Ich wusste genau, woran ich war. Wir waren ein paarmal in den Ferien und langweilten uns nie. Ich mochte sie immer lieber.» Sie putzte seine Wohnung und wusch und bügelte seine Hemden, ohne ein Wort darüber zu verlieren, während er Karriere machte. Aber nie hätte sie einen Zeitungsstapel oder einen Abfallsack die Treppe hinuntergetragen, wenn er in Reichweite war. Nach zwei Jahren schien ihm die Zwangspendelei zwischen Russland und der Schweiz nicht länger zumutbar. Seit der Hochzeit, sagt er, sei bei ihr viel Druck weg, sie sei entspannter, es sei gut.
Immer diese Angst: Was will der?
Peter, 37 Jahre alt, ist Maler, wovon er nicht leben kann, und Webdesigner, womit er sich und seine senegalesische Frau Jeannette knapp über den Monat bringt. Peter hatte auch schon vor Jeannette nur ausländische Freundinnen. «Das Psychologisieren der Schweizerinnen interessierte mich nicht: Wenn ich wütend war, war ich nicht wütend, sondern ich verdrängte etwas oder konnte mit etwas nicht umgehen. Ausserdem flirten Schweizerinnen nicht gern. Sie reagieren auf Blicke, als seien es sexuelle Übergriffe. Immer diese Angst: Was will der? Ich dachte lange, ich tue Frauen weh, wenn ich mit ihnen schlafen will. Ich hatte das so verinnerlicht, dass Frauen immer Opfer sind. Meine Generation ist wirklich am Arsch. Wir machen jetzt unsere private Revolution, indem wir Frauen nehmen, die von weit weg kommen.»
Peter klingt – es ist ein Telefoninterview – nicht halb so erbittert, wie seine Worte sich lesen. Eher erstaunt, wie sich alles fügte. «Meine Frau und ich schmettern uns die Köpfe ein. Es ist oft heavy und laut. Pünktlichkeit, Geld, sagen, wo es durchgeht. Sie zwingt mich zu Rollen, die ich früher nie einnehmen durfte. Aber sie ist so ungeheuer lebendig, sie hat keine Fassade, es ist wie ein Geschenk.» Manchmal, sagt Peter, nimmt sie das Handy und telefoniert drei Stunden mit ihrer Familie in Afrika. Weil Gespräche eben Zeit brauchen. Dann dreht er durch, sie haben das Geld nicht. Und sie bekommt Angst, die finanzielle Abhängigkeit setzt ihr zu. In solchen Momenten reden sie über Scheidung. «Aber ich hatte noch nie eine so gute Zeit wie mit ihr. Es geht etwas. Ich freu mich so, abends heim zu ihr zu kommen. Wir wollen etwas voneinander. Hier wollen alle nur in Ruhe gelassen werden.»
Fragt man Ausländerinnen, wie sie die Schweizerinnen wahrnehmen, wird das Bild nicht freundlicher. «Sie sind wie Männer», sagt Nina, die Frau von Jan. «Sie sitzen mit gespreizten Beinen auf dem kalten Boden und rauchen. Und wenn sie schnäuzen, klingt es wie ein Alphorn.» Sie findet Schweizerinnen erschreckend ungepflegt. Und anmassend in ihren Forderungen an die Männer: «Wir Ostblock-Frauen halbieren den Haushalt nicht: Ich wasche, also musst du bügeln. Wir machen ihn und diskutieren nicht, so sind wir erzogen.»
Nina versteht die fordernde Haltung vor allem deswegen nicht, «weil die Schweizerinnen alle einen Märchenprinzen suchen. Aber ihre Ansprüche sind einfach zu hoch. Eine Ausländerin, die herkommt, um einen Mann zu finden, ist bedürftig und deswegen bescheidener und zugänglicher. Die Schweizer suchen ja auch Märchenprinzessinnen, da verlieren die Schweizerinnen gegen unsere Mentalität.» Schweizer Männer, sagt ihre russische Freundin Natascha, liessen sehr viel mit sich machen. «Wir loten unsere Grenzen aus, wir sind laut und lärmig wie kleine Pinscher. Aber wenn der grosse Hund ‹flaff› macht, sind wir still. Wichtige Dinge entscheiden die Männer. Eine Schweizerin und ein Schweizer sind wie zwei grosse Hunde derselben Rasse. Das geht nicht zusammen.»
«Schweizerinnen haben harte Herzen»
Die Männerschuhe waren etwas vom Ersten, was Rolfs Frau Florence an den Schweizerinnen auffiel. «Ganz viele Frauen tragen Männerschuhe. Überhaupt kann man sie oft kaum von Männern unterscheiden. Und sie rennen ständig.» Wenn Florence ihre Familie in Ghana besucht, sagen alle, sie solle endlich ruhig gehen. «Wir lernen, dass eine Frau ihren Körper elastisch und langsam bewegen soll. Aber jetzt renne ich auch schon.» Schweizerinnen, sagt Florence, verwechselten Emanzipation mit Dominanz. «Manchmal», sagt sie, «habe ich den Eindruck, sie würden den Mann am liebsten in die alte Frauenrolle drängen. Sie sind so angespannt. Sie arbeiten nicht für sich selber, sondern für ihr Ansehen in der Gesellschaft, um zu beweisen, dass sie so gut sind wie die Männer. Warum wollen sie so hart sein? Eine Frau muss ein weiches Herz haben. Hier haben die Frauen harte Herzen. Mein Mann ist freundlich und warm. Also versuche ich ebenfalls, ihm mit Wärme zu begegnen.»
Wie Nina hält Florence die Schweizer Männer für wesentlich netter als die Frauen. «Sie sind misstrauisch, aber nicht verletzend. Ich denke, sie sind die sanftesten der Welt.» Obwohl Florence neben Haushalt und Kinderbetreuung stundenweise berufstätig ist, würde sie nie von ihrem Mann verlangen, dass er im Haushalt hilft. «Ich mache das gern. Ich bin emanzipiert, aber das bedeutet nicht Kräftemessen. Wir sind keine Konkurrenten, sondern ergänzen uns. Wenn der eine in der Sonne steht, bleibt die andere im Schatten und bereitet seine Rückkehr vor. Weil er Durst hat, wenn er heimkommt. Und weil die Frau mehr Glück hat, denn sie kann im Schatten leben.»
Männer als Freizeitgestaltung
Noch Fragen, warum ein solches Selbstverständnis männliche Sehnsüchte weckt? Schweizerinnen deuten auf den Kühlschrank, wenn der Mann Durst hat. Ein Platz im Schatten ist nicht das, was sie vom Leben wollen. Sie treten ungeduldig an Ort, weil die Männer die Sonnenbänke besetzt halten und nur zögerlich ein paar Stehplätze frei machen. Sie verstehen nicht, warum es stundenlange Verhandlungen braucht, bevor er den Teppich saugt, der beiden gehört. Karin Frick, Autorin der eingangs erwähnten GDI-Studie über die Zukunft der Frau, schreibt: «Die Frau will Erfolg, sie will Einfluss, und sie will alles zu ihren Bedingungen. Ihr Leben wird durch Kompetenz, Karriere und Konsum bestimmt. Sie denkt und handelt immer mehr wie ein Mann. Die moderne Frau interessiert sich vor allem für sich selbst. Mann und Familie sind zwar noch ein Lebensziel, aber längst nicht mehr das einzige. Die Erwartungen an den Partner werden immer grösser und die Suche nach ‹dem Richtigen› immer schwieriger. Vor allem gut ausgebildete und beruflich erfolgreiche Frauen über dreissig tun sich zunehmend schwer damit, ‹gute Männer› zum Heiraten zu finden.»
Ob man bei solchen Voraussagen aufatmet oder friert: Sie denken nur konsequent weiter, was wir bereits leben. Die Kinder von Nina und Florence werden anders aufwachsen als ihre Mütter und irgendwann Männerschuhe tragen und laut schnäuzen. Die Zahl der Schweizer, die bei Ausländerinnen aus fernen Ländern Wärme, Direktheit und klare Rollenverteilungen suchen, wird weiter ansteigen. Die Schweizerinnen werden häufiger allein bleiben, was nicht bedeutet, dass es keine Männer in ihrem Leben gibt. Aber sie fallen eher unter Freizeitgestaltung als unter Partnerschaft. Mit Ideologie wird es nichts zu tun haben. Die Praxis allerdings wird von ferne an die 68er erinnern: Der Bubentraum von gestern als Realität der Frauen von morgen.
tankwarth - 4. Mär, 19:00
Weltwoche Ausgabe 47
Ein TV-Sportjournalist geht nicht zur Arbeit, er geht seinem Hobby nach. Beim Spiel Türkei gegen die Schweiz hatte das wieder böse Folgen.
Sportkommentator Matthias Hüppi nahm seinen ganzen Mut zusammen. Die Vorgänge nach dem Türken-Spiel, deutete er im TV-Studio an, seien möglicherweise, unter Umständen, allenfalls, vielleicht doch nicht ganz normal, er meine ja nur, womöglich, es könnte ja sein. Sein Gesprächspartner Christoph Daum, Trainer von Fenerbahce Istanbul, fuhr ihm dennoch gleich übers Maul. Die Schweizer, belehrte er Hüppi, sollten «stolz sein, statt zu heulen». Jetzt sah Sportskamerad Hüppi aus wie ein eingeschüchterter Zwerghase, der eins hinter die Löffel bekommen hatte. Die Prügeleien nach dem Spiel waren ab sofort im Schweizer Sportfernsehen kein Thema mehr. Hüppi oben im Studio, wie seine Kollegen unten im Stadion, redeten nur noch über Fussball und nicht über Fusstritte, nur noch über Handelfmeter und nicht über Handgreiflichkeiten.
Ältere Fussballsemester erinnerten sich, es war genau zwanzig Jahre her. Im Heysel-Stadion in Brüssel gab es 1985 beim Meistercup-Final zwischen Liverpool und Juventus Dutzende von Toten. Reporter Beni Thurnheer kommentierte das Spiel, als wäre nichts geschehen. Dann blendete sich TV DRS wortlos aus und strahlte einen Naturfilm mit Hans A. Traber aus.
2005 war es vergleichbar, auch die Argumentation des TV-Teams war dieselbe. Was ausserhalb des Rasens geschehe, habe «nichts mit Sport zu tun». Was nichts mit Sport zu tun hat, ist nicht relevant für die Sportredaktion.
1985 setzte es nach der offenkundigen Verletzung der Informationspflicht einen TV-Skandal. 2005 setzte es nach der offenkundigen Verletzung der Informationspflicht keinen TV-Skandal. Zu gross war das patriotische Entzücken, um es mit einer Diskussion über publizistische Fehlleistungen zu versalzen.
Wir haben die rotweisse Fahne inzwischen in den Schrank gehängt und können zur nüchternen Interpretation anheben: Das Schweigen der TV-Lämmer zeigte uns wieder einmal den Unterschied zwischen Sportjournalisten und Nicht-Sportjournalisten auf. Viele Sportjournalisten haben irgendwann aus ihrem Hobby einen Beruf gemacht. Sie freuen sich, wenn sie ins Stadion fahren dürfen, weil ihnen dort beruflich vergönnt ist, was sie privat interessiert. Das unterscheidet sie von den meisten Branchenkollegen. Es gibt keinen Inlandredaktor, der darüber jauchzt, dass er die Nationalratsdebatte zum Rüstungsprogramm verfolgen darf. Und rar sind die Wirtschaftsjournalisten, die der Generalversammlung von Novartis entgegenfiebern.
Sportjournalisten begegnen ihrem Thema mit Leidenschaft und Nähe. Andere Journalisten begegnen ihren Themen mit Zynismus und Distanz. Leidenschaft und Nähe verführen zu einer protektionistischen Bewahrungshaltung. Man möchte ausklammern, was nicht sein sollte und was das Idealbild trübt. Doping, Bestechung und Gewalt – «das gehört nicht zum Sport».
Solche Romantik verhindert, wie in Istanbul, das Bemühen um Aufklärung. Nachdem Matthias Hüppi und seine Sportskollegen die objektive Information verhindert hatten, stand «10 vor 10» auf dem Programm. Dort erfuhr man aus erster Hand von den Prügelszenen im Kabinengang. «10 vor 10»-Journalisten sind normale, zynische Nachrichtenjournalisten. Sie lieben den Fussball nicht. Sie lieben ihn nur, wenn er gute Schlagzeilen liefert. Fairerweise müssen wir sagen, dass sich auch die Sportjournalisten der gedruckten Presse in den letzten Jahren emanzipiert haben. Sie solidarisieren sich immer weniger, sie recherchieren immer mehr. Die Spuck-Affäre Frei, die Doping-Affäre Camenzind, die Finanz-Affäre Blatter: Die sportiven Schonflächen sind vor allem bei grossen Tageszeitungen wie Blick, NZZ und Tages-Anzeiger enger geworden.
Im Schweizer Fernsehen hingegen hat sich die Spezies der Verwedler und Schönfärber gehalten. Nach der Fehlleistung von Istanbul verteidigte sich TV-Sportchef Urs Leutert, man hätte seine Leute «unter Androhung von Gewalt» an der Berichterstattung gehindert. Das ist natürlich Quatsch. Nicht nur «10 vor 10» informierte gleichzeitig aus dem Kabinengang vor Ort. Auch bei der ARD berichtete Reporter Nick Golüke, der selber einiges abbekommen hatte, live vor der Kamera.
Wir wollen hier den Berufsstand der Journalisten nicht heroisieren. Aber die «Androhung von Gewalt» hindert im Normalfall keinen daran, dennoch an Informationen heranzukommen. Vielleicht bekommt man keine TV-Bilder, aber Informationen bekommt man immer. Um Informationen kämpft man nur dann nicht, wenn einem ganz recht ist, dass sie nicht öffentlich werden. Die Prügelszenen von Istanbul hatten tatsächlich mit Sport nichts zu tun. Sie hatten mit Journalismus zu tun.
tankwarth - 1. Dez, 16:22
Wir sind zu arm, um uns billige Sachen zu kaufen: Ein Paar von Ludwig Reiter schützt Mensch und Umwelt.
Der Idee der Nachhaltigkeit gehört die Zukunft. Der Verbraucher ist Revolutionär. Seine Konsumgewohnheiten haben in den letzten hundert Jahren die Welt mehr verändert als der Gang zu den Wahlurnen oder auf die Strasse zur Revolution. Der grüne Vordenker Matthias Berninger bezeichnet es als Fortschritt, dass die OECD bei ihrer Auszeichnung von Waren erstmals auch die Prozessqualität berücksichtige – also nicht nur die Umweltverträglichkeit eines Produktes, sondern auch die Ökobilanz seiner Herstellung. «Die Globalisierungsdebatte braucht die Konsumentendebatte. Wenn man der Globalisierung eine Leitplanke geben will, braucht man eine Prozessqualität der Produkte, die weltweit eingehalten wird.»
Und dann entscheiden die Konsumenten über die ökologische Verfassung der globalisierten Welt – vorausgesetzt, sie verfügen über das Mindestmass an Wohlstand und Wissen, das dafür notwendig ist. Wohlhabenden Nationen wie der Schweiz fällt dabei eine besondere Vorbildfunktion zu. Ökologisch nachhaltig sind Konsumgegenstände, die potenziell die Qualität und Substanz haben, nicht nur die eigene Lebenszeit zu überstehen, sondern weitervererbt werden zu können.
Luxus ist arbeitsintensiv. Deshalb macht es Sinn, «den Sinn für Ästhetik und Luxus» zu stärken, wie der Club of Rome empfiehlt. Damit funktioniere Wachstum nicht über Mengen, sondern über Schönheit. Durch eine Reparaturgesellschaft entstehen so neue Arbeitsplätze. Bestes Beispiel: Schuhe. Normal trägt man sie ein bis zwei Jahre, um sie dann zu entsorgen. Rahmengenähte Schuhe aus Pferdeleder halten Generationen. Vorausgesetzt, man pflegt sie richtig. Ausserdem wird man wohl mindestens alle zwei bis drei Jahre die Sohlen erneuern müssen. Aber die Patina der Schuhe macht diese immer eleganter. Kein Mann, und neuerdings auch immer weniger Frauen, von Rang will ohne diese Patina durchs Leben spazieren. Meine These: Spätestens mit dreissig muss man Dinge kaufen, die bleiben: Schuhe, Möbel, Kunst, Häuser, Uhren, Geschirr, Gartenbänke. Schuhe kaufe ich seit fünf Jahren bei Ludwig Reiter, zuvor bei Eduard Meier in München. Beide Firmen waren Hoflieferanten und verfügen über eine wertvolle Tradition, die nicht zuletzt in einem beeindruckenden Herstellungswissen mündet. Seit 125 Jahren stellt Ludwig Reiter Schuhe her, die mittlerweile in gut einem Dutzend Geschäften in Europa verkauft werden. Nicht eben billig, aus Kalbsleder gefertigt, kosten «Budapester» 690 Franken, in Pferdeleder 1100 Franken.
Auf Dauer sind sie dennoch günstig. Billigere Schuhe haben eine deutlich kürzere Haltbarkeitsdauer. Dasselbe gilt übrigens für Autos. Je exklusiver Autos sind, umso seltener werden sie verschrottet. Fast 78 Prozent aller jemals produzierten Porsche gibt es noch. Wie viele Toyota Corolla der ersten Generation noch herumfahren, ist ein Geheimnis. Es dürfte ein Promille sein. Seien Sie ein stolzer Snob: Das Billige ist in der Regel ökologisch bedenklich. Der Todfeind der Nachhaltigkeit ist Ex-und-hopp-Konsum. Michael Hopf, Sprecher von Greenpeace: «Je länger ein Produkt hält, desto ökologisch sinnvoller ist es.» Hier sollten wir ausnahmsweise konservativ sein.
tankwarth - 1. Dez, 16:17
tankwarth - 26. Sep, 14:49

 Von Marcel Gamma
Von Marcel Gamma